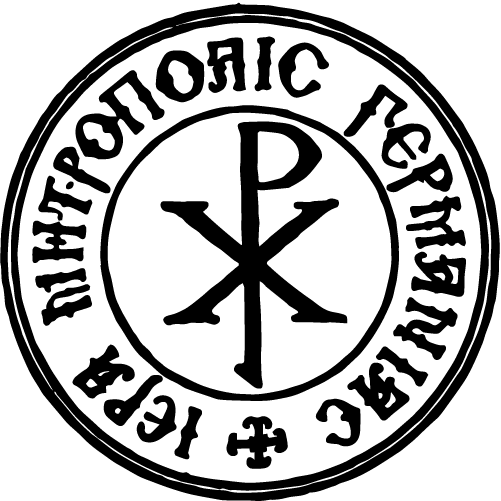Das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel, – (gr.: Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως) hat unter den weltweit 14 sog. Autokephalen Orthodoxen Kirchen den Ehrenvorrang. Unter autokephalen Kirchen (gr. Αὐτό- = auto- „selbst-“ u. Κεφαλή= kephalē „Haupt“) versteht man jene orthodoxen Kirchen, denen ein eigenes Oberhaupt vorsteht und die vollkommen unabhängig sind. Sie unterstehen keinem anderen Patriarchen, oder der Synode einer anderen Kirche. Sie wählen ihr Oberhaupt selbst. Ihr Zusammenhang mit der orthodoxen Gesamtkirche ist nicht organisatorischer Art, sondern besteht im gemeinsamen Glauben, Gottesdienst und Kirchenrecht. D. h. alle sog. nationalen Kirchen, bilden die Orthodoxe Kirche weltweit, welche einen gemeinsamen Glauben bezeugt, trotz struktureller und organisatorischer Vielfalt.
Diese 14 autokephalen orthodoxen Kirchen und deren Vorsteher sind:
Das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel, S. Allheiligkeit, der Ökumenische Patriarch Bartholomaios
Das Patriarchat von Alexandria und ganz Afrika, S. Seligkeit, Patriarch Theodoros II.
Das Patriarchat von Antiochia und dem ganzen Osten, S. Seligkeit, Patriarch Johannes X.
Das Patriarchat von Jerusalem, S. Seligkeit, Patriarch Theophilos III.
Das Patriarchat von Moskau und ganz Russland, S. Seligkeit, Patriarch Kyrill
Das Patriarchat von Serbien, S. Seligkeit, Patriarch Irinej
Das Patriarchat von Rumänien, S. Seligkeit, Patriarch Daniil
Das Patriarchat von Bulgarien, S. Seligkeit, Patriarch Neofit
Das Patriarchat von Georgien, S. Seligkeit, Patriarch Ilia II.
Das Erzbistum von Zypern, S. Seligkeit, Erzbischof Chrysostomos II.
Das Erzbistum von Griechenland, S. Seligkeit, Ieronymos II., Erzbischof von Athen
Das Erzbistum von Polen, S. Seligkeit, Erzbischof Sabas von Warschau
Die orthodoxe Kirche von Albanien, S. Seligkeit, Erzbischof Anastasios von Tirana
Das Erzbistum Tschechiens und der Slowakei, Kom. Erzbischof Krystof
Es gibt darüber hinaus noch die Kirchen von Estland und von Finnland. Im Gegensatz zu den eben aufgezählten, sind diese beiden autonome Kirchen. Diese sind nur im Inneren unabhängig, bei der Benennung ihres Oberhauptes hat eine übergeordnete Kirche ein Mitspracherecht.
Das Oberhaupt der des ökumenischen Patriarchats ist S. Allheiligkeit, der Ökumenische Patriarch Bartholomaios. Als „primus inter pares“, also als „Erster unter Gleichen“, ist er das geistliche Ehrenoberhaupt von etwa 350 Millionen orthodoxen Christen weltweit. Der Patriarch hat seinen Sitz im Kloster der Hl. Georg im Stadtteil Fener in Istanbul, – ehemals Konstantinopel. Die Kathedrale des Patriarchats ist dem Hl. Großmärtyrer Georgios geweiht. Bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453, war über 9 Jahrhunderte hinweg die Hagia Sofia Sitz des Patriarchen.
Die Apostolische Kirche von Konstantinopel
Die Apostel wurden von Christus ausgesandt, um allen Völkern das Evangelium zu ihrem Heil zu predigen. Es gelang ihnen auf wundersame Weise, trotz aller widrigen Umstände, der Verfolgungen und der stets gefährlichen Lebensbedingungen, Kraft des Heiligen Geistes, der ganzen Ökumene, allen Völkern also, das Christentum in kürzester Zeit zu verkünden.
Das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel ist das höchste kirchliche Zentrum der Orthodoxen Kirche weltweit. Seine Gründung geht auf die Pfingstgeschehnisse und die ersten christlichen Gemeinden zurück, die von den Jüngern und Aposteln Christi gegründet wurden. Der Überlieferung nach predigte der Erstberufene unter ihnen, der Apostel Andreas, das Evangelium Christi in weiten Teilen Kleinasiens, am Schwarzen Meer, in Thrakien und Achaia, wo er auch den Märtyrertod fand. Im Jahre 36 gründete der Apostel Andreas die Kirche am Bosporus, in der Stadt die damals Byzanz, später Konstantinopel hieß und heute Istanbul genannt wird. Die Kirchen von Konstantinopel, Trapezunt und Patras, ehren den Apostel bis heute als ihren Gründer und Schutzpatron. Der heilige Andreas ist der Schutzheilige des Ökumenischen Patriarchats und der Tag seines heiligen Gedenkens wird am 30. November gefeiert.
Die Feier dieses besonderen Festes, kurz unterbrochen zu Beginn der osmanischen Herrschaft, wurde unter dem Ökumenischen Patriarchen Seraphim II im 18. Jahrhundert fester Bestandteil des liturgischen Lebens in Konstantinopel, und ist es bis heute. Im Jahr 356, wurden die Reliquien des Apostels nach Konstantinopel überführt. Er erfreut sich in der Stadt besonderer Beliebtheit, was der Bau vieler Kirchen zu seine Ehren unterstreicht.
Die Apostolizität des Throns von Konstantinopel wird auch durch das Wirken des Apostels und Evangelisten Johannes bezeugt. Das Buch der Offenbarung sendet er an „die sieben in den Kirchen zu in Asien“. Diese sind die Kirchen von Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Diese Bistümer gehören seit dem 4. Jh. zum Zuständigkeitsbereich der Kirche von Konstantinopel. Der Ökumenischen Patriarchen Ignatius sagte auf der Synode (86I), den Vertretern des Papstes, welche die Apostolizität des Thrones von Rom hervorhoben „Ich habe den Thron des Apostels Johannes und Apostel Andreas inne“.
Die Kirche von Konstantinopel begründet ihren Apostolischen Charakte jedoch auch in der Tatsache, dass ihre besondere Stellung innerhalb des ersten christlichen oder auch christlich-geprägten Weltreiches eine erfolgreiche Mission ermöglichte, in deren Zuge auf bemerkenswerte Art und Weise das Evangelium Jesu Christi seine Verbreitung unter zahlreichen Nationen fand, ausgehend von einer Stadt, deren erster christlicher Kaiser ihr seinen Namen gab.
Die alte Handelsstadt „Byzantion“ am Bosporus, damals nur Sitz eines Diözesansbischofs, wurde im Jahr 330 n. Chr. von Kaiser Konstantin zur neuen Hauptstadt seines Neuen, des Neuen Oströmischen Reiches erhoben. Der Bischof der Stadt erhielt bedingt durch die Entwicklung nicht nur die Rechte und Privilegien des Bischofs vom alten Rom, sondern auch durch einem Beschluss des 2. Ökumenischen Konzils, welches 381 n.Chr. in Konstantinopel stattfand, in der Rangfolge der sog. „Pentarchie“, also der Aufzählung der 5 Ehrwürdigen Patriarchate, nach Rom die 2. Rangstelle, vor Alexandria, Antiochien und Jerusalem. In der byzantinischen Zeit erweiterte es, auch unterstützt durch die Expansionspolitik des neugegründeten Reiches, aber auch durch Einflussverluste der anderen Patriarchate, die große Bereiche durch arabische Eroberungen verloren hatten, und durch die Slawenmission im 9. Jh., seine geistliche Autorität und seinen kirchlichen Einfluss weit über die Grenzen des oströmischen Reiches hinaus.
Der Apostel Andreas setzte den Apostel Stachys als ersten Bischof der zu Beginn kleinen und unwichtigen Handelskolonie. Auf ihn folgten in den kommenden Jahrhunderten weitere vierundzwanzig Bischöfe, als letzter der Hl. Mitrofanis, der aller Wahrscheinlichkeit nach der erste Erzbischof war. Dies wird in vielen alten Quellen erwähnt. Sein Patriarchat beschließt die erste historische Periode der Stadt als christliches Zentrum. Darauf folgt die Glanzzeit des über ein Jahrtausend währenden byzantinischen Reiches, in dem die Kirche von Konstantinopel, sich vom einfachen Bistum zum Erzbistum, Patriarchat, Ökumenisches Thron und Großer Kirche Christi entwickelte, wobei sie trotz mannigfaltiger Umwälzungen und Veränderungen einen stabilen und maßgeblichen Faktor, eine Institution von Ökumenischer Tragweite eben darstellte, welche Pracht und Glanz der griechisch-römisch-christlichen Kaiserreiches maßgeblich prägte.
Glanz der Kaiserstadt
Wie bereits bekannt sein dürfte, war Verbreitung des Christentums in der Hellenistischen Zeit wegweisend für die weitere Entwicklung der Gesellschaft. Die großen hellenistischen Zentren der Antike waren gleichsam die Ausgangspunkte für die missionarische Tätigkeit vieler Apostel, so auch des Apostel Andreas und Paulus.
Es ist unbestritten, dass die Missionen des Apostels Paulus das Bild der damaligen Zeit nachhaltig prägten. Auf diesem Nährboden wurde die Stadt des Konstantin in einem geographischen Gebiet gegründet, wo die Verbreitung des christlichen Zeugnisses viele Ortskirchen hervorgebracht hatte. Auf diesen Umstand ist die Zuständigkeit der Kirche von Konstantinopel vor allem für die Kirchen und Gemeinde in Kleinasien, aber auch entlang der Schwarzmeerküste, zurückzuführen.
Durch die Gründung der neuen Hauptstadt, und die Erhebung ihres Bischofs zum Erzbischof, förderte Kaiser Konstantin der Große das Christentum und machte Byzanz zur Zweiten Hauptstadt des Römischen Reiches, das von da an als „Neues Rom“ und als „Konstantinopolis“ bezeichnet wurde. Da dies erst 330 n.Chr. geschah, wird das Bistum von Byzantion auf dem 1. Ökumenischen Konzil 325 nicht erwähnt. In den darauffolgenden Jahren formte entwickelte sich die Kirche der Hauptstadt zu einem geistlichen Zentrum.
In den mehr als 50 Jahren zwischen dem 1. und dem 2. Ökumenischen Konzil 381 n.Chr. wuchs der Einfluss der Erzbischöfe des Neuen Rom, was auch durch die Tatsache, dass nach dem Tod des Bischofs Meletios von Antiochien, der Erzbischof von Konstantinopel und Hl. unserer Kirche Gregor der Theologe und nach dessen Rücktritt, sein Nachfolger Nektarios von Konstantinopel dem Konzil vorstanden. Ebendieses Konzil von Konstantinopel, bekräftigte durch den 3. Kanon die Rangstellung der Kirche von Konstantinopel, indem er ihr die gleichen Ehrenrechte (presbeia) wie der Kirche von Rom und der zweite Platz nach ihr einräumte. Dieser Kanon war keine Erfindung der Stunde, sondern das Resultat der Entwicklung der vorangegangenen Jahrzehnte.
Auf dem Konzil von Chalcedon 451 wurde in Revision des zweiten Ökumenischen Konzils die besondere Stellung der Kirche von Konstantinopel unterstrichen und bestätigt. Darüber hinaus wird ihr durch den 28. Kanon die Verantwortung für alle unter den sog. „Barbarenvölkern“ in der Diaspora lebenden Gläubigen, übertragen. Dies gilt streng genommen immer noch. Die geschichtliche Entwicklung brachte es mit sich, dass mittlerweile alle Orthodoxen Kirchen Bischöfe in die Diaspora entsenden, die sich der Belange ihrer Gläubigen annehmen. Darüber hinaus wurde dem Patriarchen von Konstantinopel nicht nur die Jurisdiktion über wichtige Erzdiözesen wie Pontus, Asia und Thracien gegeben, sondern auch der 381 festgelegte Vorrang Roms vor Konstantinopel aufgehoben. Der Bischof von Konstantinopel hat nunmehr nicht nur die gleichen Ehrenrechte, sondern gemeinsam mit dem alten Rom die gleiche Rangstellung. Man sprach nun auf gleicher Augenhöhe.
Eine weitere Besonderheit dieses Konzils, war die Zusprechung des Rechts, im Falle einer Krisensituation, auch exterritorial entscheiden zu dürfen. Dieses Vorrecht hat allein die Kirche von Konstantinopel. Diese privilegierte Stellung erschließt sich aus kanonischen Vorgaben und bildet innerhalb der Orthodoxen Kirche eine juristische und natürliche Konstante. Ohne Die Kirche von Konstantinopel wären diese Entwicklungen nicht möglich. Ohne ihren Einsatz bei Formulierung von Dogmen und Kanones, bei der Einberufung der Synoden, die immer unter dem höchsten Vorsitz eines Kaisers oder einer Kaiserin stattfanden, die Fürsorge für das monastische Leben und seien Tradition, der theologischen und christlichen Präsenz, sowie der Zusammenarbeit, der SYNERGIA innerhalb des Kaiserreichs, ist ein Beispiel für eine Koexistenz in Christus. Die umfangreiche missionarische Tätigkeit, insbesondere im 9. und 10. Jahrhundert unter den Slawenvölkern und ihre Evangelisierung haben zur kulturellen und spirituellen Formung ebendieser beigetragen. Da die Kirche von Konstantinopel durch ihr Einwirken vielen Völkern den christlichen Glauben näherbrachte, wird sie auch Mutterkirche genannt. Eine Mutterkirche, welche unentwegt über ihre Kinder wacht und mit Stolz und voller Freude ihre Entwicklung beobachtet.
Weitere Informationen unter: www.ec-patr.org